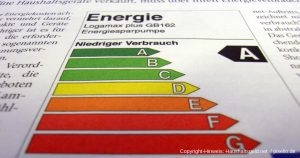Eine Stadt zum Anbeißen. Diese scheinbar verrückte Idee hat Schule gemacht. Andernach war eine der ersten Kommunen, die angefangen haben auf öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen Obst- und Gemüse anzubauen. Alle Lebensmittel sind frei zugänglich und das Ernten ist explizit erlaubt. Gartenbegeisterte tun sich zusammen und schaffen in der Gemeinschaft integrative Orte, die ganz unterschiedliche Bevölkerungsgruppen verbinden. Gleichgesinnte Kommunen haben 2019 den gleichnamigen Verein gegründet.
Häufig werden Schulgärten in die Aktivitäten einbezogen. Auf diese Weise wird der Spaß am Gärtnern, der sensible Umgang mit Lebensmitteln und das traditionelle Wissen zu Anbautechniken früh vermittelt und die Gärten sind gleichzeitig Lernorte nachhaltiger Bildung. Wer auf dem Schulgelände keine geeigneten Grünflächen hat, könnte sich von Edgar, dem mobilen Gewächshauses als Schulgarten inspirieren lassen.
Auch in Baden-Württemberg haben sich bereits viele Städte und Gemeinden auf den Weg gemacht durch urbane Landwirtschaftsprojekte die Artenvielfalt an Pflanzen und Tieren zu erhalten. Waldkirch erhielt für ihre „essbare“ Stadt beispielsweise eine Auszeichnung im Rahmen der UN-Dekade Biologische Vielfalt und war Gewinner beim Landeswettbewerb „Baden-Württemberg blüht“.
Bei den Anbautechniken sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Neben den klassischen Gemeinschaftsgärten gibt es auch bepflanzte Gemüsekisten auf Dächern von Industrieanlagen oder Wohnblöcken. Indem einfach da gegärtnert wird, wo die Menschen eh schon leben und arbeiten, entfällt der Freizeitverkehr zu den Schrebergartensiedlungen, wie das Ministerium für Verkehr Baden-Württemberg in seinem Magazinbeitrag „Urban Gardening“ 2019 hervorhebt.
Beispiel: Die Stadt Ulm hat die Idee der „essbaren“ Stadt auf öffentlich zugängliche Obstbäume sowie Wildkräuter ausgeweitet. In Kooperation mit mundraub.org bietet die Stadt mittels einer Übersichtskarte eine Plattform, auf der Standorte, wo legal Lebensmittel geerntet werden können gefunden und selbst eingetragen werden können.
Beispiel: In Freiburg hat der Ernährungsrat Interessierte und die Stadt in einer Veranstaltung zusammengebracht und einen „Aktionsplan essbare Stadt“ erarbeitet.
GAR BW-Tipp:
Meist arbeiten eine Vielzahl an Akteuren vor Ort an der Thematik, die bei Ratsinitiativen eingebunden werden sollten.