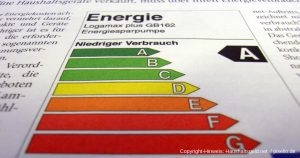Land unterstützt die Kommunen beim Ausbau des Biotopverbundes
Von Dr. Markus Rösler, MdL & Dr. Julia Ohl-Schacherer. Veröffentlicht Dezember 2022, aktualisiert Januar 2025.
Der Ausbau des Biotopverbundes ist ein wichtiger Baustein, um das dramatische Artensterben zu bremsen. Das Land Baden-Württemberg hat daher im Rahmen des Biodiversitätsstärkungsgesetzes weitere finanzielle Mittel bereitgestellt, um den Ausbau des Biotopverbundes bis 2030 zu beschleunigen.
Wichtigster Player sind dabei die Kommunen, die das Land bei einer Biotopverbundplanung mit 90 % der Planungskosten unterstützt.
Auch die anschließenden Umsetzungsmaßnahmen werden über die Landschaftspflegerichtlinie mit bis zu 100 % gefördert.
Was ist der landesweite Biotopverbund?
Der Biotopverbund bezeichnet die Vernetzung von Lebensräumen von Tieren und Pflanzen, um den genetischen Austausch zu ermöglichen. Dabei werden die Verbindungen der Lebensgemeinschaften bewahrt und wo möglich, funktionsfähige ökologische Wechselbeziehungen wiederhergestellt.
Bereits seit 2002 ist der Biotopverbund gesetzlich im Bundesnaturschutzgesetz verankert. Mindestens 10 % der Landesfläche sollen Teil des Biotopverbundes sein. Im Zuge des Biodiversitätsstärkungsgesetzes im Jahr 2020 wurde im Naturschutzgesetz des Landes festgelegt, dass der Biotopverbund bis 2023 auf 10 %, bis 2027 auf 13 % und bis 2030 auf 15 % Offenland der Landesfläche etabliert werden soll. Hierbei geht es ausdrücklich um das Offenland, wo die größten Verbunddefizite aktuell bestehen.
Grundlage für die Biotopverbundplanung ist der „Fachplan Landesweiter Biotopverbund“, der auf digitalen Daten sowie unterschiedlichen Kartierungen (wie z.B. Flächen des Artenschutzprogramms, landesweite FFH-Mähwiesenkartierung, Generalwildwegeplan…) basiert.
- Diesen Fachplan kann man sich in großem Maßstab für jede Kommune im Land im Kartendienst der LUBW herunterladen: > hier abrufen (Dann die jeweiligen Unterabschnitten aufrufen: > Natur und Landschaft / Biotopverbund / Biotopverbund Offenland inkl. Generalwildwegeplan)
Wie ist der Fachplan Biotopverbund aufgebaut und wie verbindlich ist er?
Der Biotopverbund unterscheidet zwischen Kernflächen bzw. –räumen und Suchräumen:
- Kernflächen/ Kernräume enthalten wertvolle Vorkommen von Tieren und Pflanzen, die sich von hier ausbreiten und austauschen können. Ziel ist es diese Kernflächen und Kernräume zu erhalten und zu pflegen, sowie auszuweiten und zu verbessern.
- Suchräume bezeichnen Räume, die sich für Trittsteine eignen können, damit Tiere und Pflanzen weiter entfernt liegende Lebensräume erreichen können. Sie geben Hinweise auf die kürzesten Verbindungen zwischen den Kernflächen bzw. Kernräumen und dienen als Planungshilfe. Beispiele sind Säume oder Blühstreifen entlang von Wegen, Äckern, Wäldern oder Gewässerrändern.
! Wichtig für Rätinnen und Räte: Der „Fachplan Biotopverbund“ ist bisher gesetzlich nicht bindend – es handelt sich um einen Plan, der vor Ort konkretisiert, korrigiert und umgesetzt werden muss. Es ist nun die Aufgabe und gesetzliche Pflicht (Paragraf 22 Naturschutzgesetz) der Kommunen diese Konkretisierungen und Korrekturen vorzunehmen sowie für die Umsetzung zu sorgen. Das kann durch die Erstellung eines Biotopverbundplanes oder auch durch die Aktualisierung der Landschafts- und Grünordnungspläne erfolgen.
Welche Vorgehensweise empfiehlt sich für die Planung eines kommunalen Biotopverbundes?
Sollte Eure Kommune noch keine Biotopverbundplanung in Angriff genommen haben, könntet Ihr einen entsprechenden Antrag stellen.
Hat sich die Kommune für die Erstellung eines Biotopverbundplanes oder die Aktualisierung der Landschafts- und Grünordnungspläne entschieden, sollten zunächst die Biotopverbundbotschafter*innen bei den Landschaftserhaltungsverbänden informiert werden. Diese beraten und begleiten ihre Mitgliedsgemeinden bei einem solchen Prozess von der Planung bis zur Umsetzung. Die Pläne selbst werden von einem geeigneten und möglichst im Bereich Biotopverbund erfahrenen Planungsbüro erstellt. Um Akzeptanz für die Umsetzung zu schaffen, empfiehlt es sich Flächeneigentümer*innen, Landnutzende und Naturschutzverbände frühzeitig einzubinden.
Auch ist es möglich, dass sich mehrere Gemeinden für die Erstellung einer Biotopverbundplanung zusammenschließen.
Welche einzelnen Schritte sind bei der Biotopverbundplanung und -umsetzung erforderlich?
- Kernflächen/ Kernräume im Gelände überprüfen, anpassen und wenn möglich ausweiten
- Suchräume anhand der tatsächlichen Gegebenheiten überprüfen, anpassen und verbinden
- Flächenverfügbarkeit prüfen
- Sinnvolle Maßnahmen im Gelände planen, konkretisieren und mit Bewirtschafter*innen umsetzen: z.B. naturverträgliche Bewirtschaftung von Mähwiesen, Revitalisierung alter Streuobstbestände, Renaturierung von Fließgewässern und Gewässerrandstreifen, Aufwertung für Wiesenbrüter durch Entfernung von Gehölzen.
- Freiwillig: Die Flächen rechtlich sichern.
- Kernflächen sind i.d.R. bereits gesichert, z.B. als gesetzlich geschützte Biotope, FFH-Lebensraumtypen, FFH-Lebensstätten, Streuobstbestände (§ 33a NatSchG) oder geschützte Landschaftsbestandteile.
- Sonstige Flächen in den Flächennutzungsplan, die Baupläne sowie Grünordnungspläne aufnehmen.
Welche Vorteile bietet die Biotopverbundplanung einer Gemeinde?
- wesentlicher Beitrag zum Biotop- und Artenschutz
- umfassender Überblick über den Zustand der Natur im Gemeindegebiet
- trägt zur Ausgestaltung eines attraktiven Umfelds zur Naherholung bei
- kann als Grundlage für eine vorrausschauende Bauflächenentwicklung genutzt werden, z.B. durch gezieltes Einbeziehen gemeindeeigener Flurstücke (aktives Liegenschaftsmanagement)
- Maßnahmen des Biotopverbundes können zur Kompensation genutzt werden
- zahlreiche Synergieeffekte mit anderen Planungen durch die Fortschreibung von Grünordnungs- und Landschaftsplänen und die Integration in Bebauungs- und Flächennutzungspläne
Wichtig: Bitte macht Eure Kommunen auf die Fördermöglichkeiten durch das Land aufmerksam und setzt Euch für eine baldige Biotopverbundplanung und ganz besonders für deren Umsetzung ein!
Fachplan Biotopverbund für jede Kommune im Land im Kartendienst der LUBW herunterladen: > hier abrufen (Dann die jeweiligen Unterabschnitten aufrufen: > Natur und Landschaft / Biotopverbund / Biotopverbund Offenland inkl. Generalwildwegeplan)
Weitere Arbeitshilfen zur Biotopverbundplanung findet Ihr unter bei der Landesanstalt für Umwelt > hier klicken
Wie läuft die Umsetzung bisher?
Das gesetzliche Ziel von 10% Biotopverbundanteil am Offenland für 2023 ist mit 10,9% (10,06% Kernflächen + 0,88% Trittsteinen) von Land und Kommunen mit dem Engagement insbesondere der Landschaftserhaltungsverbände erreicht worden.
Der nächste konkrete Schritt ist das Ziel von 13% bis 2027.
Im September 2024 befanden sich 130 Gemeinden in BW „in Vorbereitung“ einer Biotopverbundplanung, 332 Gemeinden waren mitten „in (der) Bearbeitung“, während 74 Gemeinden ihre Planung bereits „vollständig abgeschlossen“ hatten und sieben Gemeinden sie „abgeschlossen für Teilbereiche“ hatten. Damit sind bis September 2024 von allen Gemeinden in Baden-Württemberg ca. 49% bereits aktiv geworden.
Weitere umfangreiche Infos zum Biotopverbund findet ihr hier.