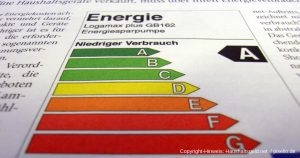Was ist eine Verpackungssteuer?
Die Verpackungssteuer ist eine kommunale Steuer auf Einwegverpackungen, -geschirr und -besteck, die in Verkaufsstellen für Speisen und Getränke für den sofortigen Verzehr ausgegeben werden. Ziel ist es, durch finanzielle Anreize den Umstieg auf Mehrweglösungen zu fördern und das Müllaufkommen zu reduzieren.
Ein Beispiel ist die Tübinger Verpackungssteuer, die seit dem 1. Januar 2022 erhoben wird. Die Steuer beträgt:
- 0,50 Euro pro Einwegverpackung (z. B. Kaffeebecher)
- 0,50 Euro pro Einweggeschirr (z. B. Pommesschale)
- 0,20 Euro pro Einwegbesteck oder Hilfsmittel (z. B. Trinkhalm)
Mehrwegverpackungen sind von der Steuer befreit, was den Umstieg für Betriebe attraktiver macht. Und auch für Bürgerinnen und Bürger wird ein Anreiz gesetzt, Mehrweg-Geschirr zu nutzen.
Die juristische Lage: Das Urteil zur Tübinger Verpackungssteuer
Die Rechtmäßigkeit der Tübinger Verpackungssteuer wurde lange gerichtlich überprüft. Nachdem der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg die Satzung 2022 zunächst für unwirksam erklärte, entschied das Bundesverwaltungsgericht im Mai 2023, dass die Steuer zulässig ist. Die endgültige Bestätigung erfolgte durch das Bundesverfassungsgericht am 22. Januar 2025. Einige Kommunen hatten ihre Pläne für eine Verpackungssteuer während der juristischen Prüfung auf Eis gelegt, nun nimmt die Debatte an vielen Orten wieder Fahrt auf.
Das Gericht begründete seine Entscheidung damit, dass es sich bei der Verpackungssteuer um eine örtliche Verbrauchsteuer handelt, für die Kommunen die Gesetzgebungskompetenz besitzen. Zudem wurde festgestellt, dass die Steuer nicht im Widerspruch zum bundesrechtlichen Abfallrecht steht und keine unzumutbare Einschränkung der Berufsfreiheit darstellt. Damit ist nun klar: Kommunen dürfen eine Verpackungssteuer einführen, sofern sie die gesetzlichen Rahmenbedingungen einhalten.
Vorteile und Herausforderungen der Verpackungssteuer
Positive Effekte für Umwelt und Haushalt
- Finanzielle Entlastung: Die Stadt Tübingen nahm beispielsweise im ersten Jahr rund eine Million Euro ein, die für die Müllbeseitigung und Umweltprojekte genutzt wurden.
- Mehr Mehrweg-Nutzung: Die Verpackungssteuer hat nachweislich Mehrweg-Angebote von Restaurants und Cafés in Tübingen stimuliert.
Müllvermeidung: In Tübingen sank nach eigenen Angaben das Müllaufkommen im öffentlichen Raum innerhalb des ersten Monats um fünf bis 15 Prozent. Da Verpackungsmüll jedoch nur ca. 20% des Mülls in städtischen Abfalleimern ausmacht, ist die Wirkungsmöglichkeit begrenzt.
Herausforderungen und Kritik
- Zusätzliche Kosten für Betriebe: Gastronomiebetriebe müssen die Steuer entweder selbst tragen oder an Kunden weitergeben, was zu Umsatzeinbußen führen kann. Außerdem ist die Erhebung der Steuer mit bürokratischem Aufwand verbunden.
- Soziale Gerechtigkeit: Kritiker argumentieren, dass Menschen mit geringem Einkommen durch die Zusatzkosten stärker belastet werden.
- Unterschiedliche Besteuerung: Nicht alle Einwegverpackungen fallen unter die Steuer, was zu Unverständnis führen kann (z. B. keine Besteuerung von Drive-In-Verpackungen).
Für welche Kommunen ist die Verpackungssteuer sinnvoll?
Die Verpackungssteuer ist besonders für Städte und Gemeinden mit einer hohen Dichte an Gastronomiebetrieben und einer ausgeprägten To-Go-Kultur relevant. In kleineren Kommunen mit wenigen Imbissen oder Cafés könnte der Verwaltungsaufwand den Nutzen übersteigen.
Kommunen sollten vor einer Einführung prüfen:
- Wie hoch das jährliche Müllaufkommen durch Einwegverpackungen ist.
- Welche Kosten durch die Müllentsorgung entstehen.
- Welche einmaligen und laufenden Kosten durch Einführung und Erhebung für die Kommune entstehen.
Aktuell diskutieren, prüfen und planen folgende Kommunen in BW eine Verpackungssteuer (Aufzählung nicht abschließend): Esslingen, Heidelberg, Karlsruhe, Mannheim, Meersburg, Ravensburg, Rheinfelden, Rottweil, Schwäbisch Hall, Stuttgart, Ulm, Villingen-Schwenningen, Weil am Rhein. Bereits eingeführt ist die Verpackungssteuer in Tübingen und Konstanz. Mehr Info dazu gibt es hier.
Nicht überall kann sich die Verpackungssteuer durchsetzen. Abgelehnt wurden Anträge zur Einführung einer Verpackungssteuer z.B. in Offenburg.
Wie können Grüne Gemeinderäte das Thema voranbringen?
Für Gemeinderätinnen und Gemeinderäte, die sich für die Einführung einer Verpackungssteuer in ihrer Kommune einsetzen wollen, bieten sich folgende Schritte an:
- Informationsgewinnung (Musteranfrage)
- Die Verwaltung beauftragen, eine Bestandsaufnahme zur Müllbelastung und den Entsorgungskosten durchzuführen.
- Klärung der zu erwartenden Einnahmen und des Verwaltungsaufwands für die Einführung und Erhebung der Steuer.
- Dialog mit Gastronomie und Verwaltung
- Austausch mit lokalen Gastronomiebetrieben über mögliche Herausforderungen und Unterstützung bei der Umstellung auf Mehrwegsysteme.
- Prüfung von Fördermöglichkeiten für Mehrwegsysteme.
- Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation
- Informieren der Bürgerinnen und Bürger über die Vorteile der Verpackungssteuer.
- Zusammenarbeit mit Umweltverbänden.
- Austausch mit anderen Kommunen, die bereits eine Verpackungssteuer eingeführt haben.
- Antrag im Gemeinderat stellen (Musterantrag)
- Prüfen, ob eine Einführung konkret vor Ort sinnvoll ist.
- Einen Antrag einbringen, der die Verwaltung mit der Einführung der Verpackungssteuer beauftragt.
Mit der jüngsten Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts haben Kommunen nun Rechtssicherheit bei der Einführung einer Verpackungssteuer. Für Städte mit ausgeprägter To-Go-Kultur kann die Steuer ein wirksames Instrument zur Ressourcenschonung, Anreiz für Mehrwegsysteme und Finanzierung von Müllbeseitigung sein. Grüne und grünennahe Gemeinderätinnen und Gemeinderäte können durch gezielte Initiativen dazu beitragen, dass auch ihre Kommune diese Möglichkeit prüft und gegebenenfalls umsetzt.

Katharina Eckert
Referentin der Geschäftsführung